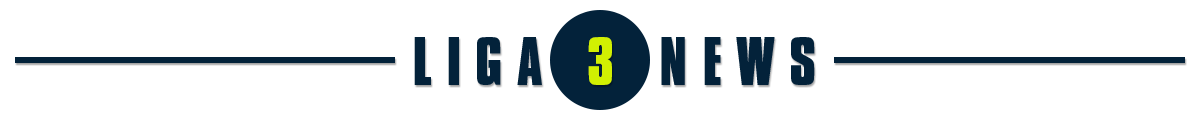Ein blaues Waldhof-Trikot im Fritz-Walter-Stadion, bewusst gewählt, nicht um zu reizen, sondern um zu reden. Thomas Melchior war 13 Jahre lang spielsüchtig, hat 800.000 Euro Schulden gemacht und saß über drei Jahre im Gefängnis. Nun sucht er den Dialog dort, wo Fußball Leidenschaft weckt: direkt vor dem Stadion. Seine Mission: Aufklärung ohne Zeigefinger, besonders für junge Fans. Im Interview mit Liga3-News spricht er über seine bisherigen Erfahrungen mit der Aktion.
Vom Absturz zur Aufklärung
Melchior spricht offen über seine Vergangenheit – Lügen, Betrug, Diebstahl – und den langen Weg zurück. Heute arbeitet er mit einer Münchner Produktionsfirma an Aufklärungs-Videos zu Sucht, mentaler Gesundheit und Drogenprävention. Sein Zielpublikum: Jugendliche und junge Erwachsene im Stadionumfeld, „wo Prävention oft am meisten gebraucht wird“. Ich habe wirklich sehr viele Jahre, auch nach meiner Haftentlassung, nach einer Möglichkeit gesucht, dem schwierigen Thema Spielsucht eine Schleife zu binden, sodass die Mehrheit es versteht und auch erst einmal bereit ist, mir zuzuhören„, verrät Melchior gegenüber Liga3-news.
Warum das Waldhof-Trikot am Betzenberg?
Der bewusste Bruch mit einer der tiefsten Rivalitäten im Südwesten sollte nicht nur provozieren, sondern auch Aufmerksamkeit binden, die wichtigste Ressource im Kampf gegen eine oft unsichtbare Sucht. „Wenn es dieses drastische Mittel braucht, um im Trikot von Waldhof auf dem Betze zu stehen und darauf aufmerksam zu machen, dann ist das tatsächlich das richtige Mittel.“ Die Idee: Inmitten „lauter Roter“ fällt ein blaues Trikot auf, zusammen mit dem Schild „Wette verloren“. Das erzeugt Reibung, öffnet Gespräche und macht die Mechanik von Grenzverschiebungen in der Spielsucht sichtbar.
Prävention im Stadion: Melchior setzt Zeichen gegen Spielsucht
@sportwettensheriff Mit Waldhof-Trikot in Kaiserlautern! #wetteverloren #betze #svw07 #fyp
Junge Fans wirklich erreichen – warum das Stadion der Fußgängerzone vorzuziehen ist
Melchior sieht Social-Media-Formate als Türöffner, die Begegnung vor Ort aber als entscheidend. Klassische Kampagnen im Pavillon verfehlen seiner Erfahrung nach die Zielgruppe. „Klassische Präventionskampagnen, die funktionieren alle überhaupt nicht. (…) Aufmerksamkeit ist eine große Währung heutzutage. Die muss man erst mal bekommen.“ Die Reaktionen am Betzenberg beschreibt er mehrheitlich als konstruktiv, inklusive Selfies mit jungen FCK-Fans trotz Rivalentrikot. Das zeige, wie sehr die Community bereit sei, den Sinn hinter der Aktion zu erkennen.
„Fußball verbindet – Tipico entzweit“: Kritik an Wettwerbung
Melchior kritisiert scharf die Präsenz von Sportwettenwerbung im Profi-Fußball und die damit verbundene Normalisierung. Gerade für Minderjährige, die die Botschaften früh internalisieren, sieht er negative Folgen. „Insbesondere der DFB bietet Anbietern wie Tipico einen derart großen Raum, dass auf dem Rücken der Fans eine Sucht unters Volk gebracht wird, die einfach nicht in den Sport gehört.“ Seine Forderung: Verantwortung vor Einnahmen und klare Schutzräume für junge Fans.
Brücken zu Fanprojekten – was sich bereits bewegt
Konkrete Club-Kooperationen sind durch die Liga-Verträge sensibel, sagt Melchior. Gleichwohl melden sich Fanprojekte. „Fanprojekte sind auf mich zugekommen. Ich bin in Mainz, in Hamburg beim HSV und auch beim FC St. Pauli. Also auch da bewegt sich viel“, verrät der heute 46-Jährige unserer Redaktion. Ein Verein sei bereits aktiv auf ihn zugekommen, Namen möchte er aktuell jedoch nicht nennen.
Dialog statt Dogma – und eine klare rote Linie
Rivalität? Ja. Gewalt? Nein. Melchior plädiert für Streitkultur ohne körperliche Eskalation und für mehr Gelassenheit gegenüber „andersfarbigen Stoffen“. „Rivalität ist in Ordnung, aber Gewalt ist absolut inakzeptabel.“ In Kürze erscheint Melchiors neues Buch „Im Kampf gegen Spielsucht und Wettmafia“, begleitet von Auftritten rund um die Frankfurter Buchmesse. Sein Appell an Fans und Umfeld bleibt deutlich: früh handeln, Gespräche suchen, aber kein Geld geben. Sein Schlusswort als letzte Botschaft: „Fußball verbindet, Tipico entzweit.“
Hilfe finden
Wer selbst betroffen ist oder Angehörige unterstützen will, sollte frühzeitig das Gespräch suchen. Unabhängige Beratungsangebote vor Ort (Suchtberatung, Caritas/Diakonie, Kommunale Stellen) sowie bundesweite Hotlines helfen beim ersten Schritt. Kein Geld geben, stattdessen professionelle Hilfe vermitteln.